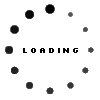Erschienen in der NZZ Zeitbilder am 30. September 2006
Fotos Elaine Briere, Vancouver , www.elainebriere.ca
Vom Alltag der Busch-Piloten an der Küste von British Columbia.

Sieht nach einem ruhigen Tag aus, sagt Chefpilot Carl Benson. Da kommt der Anruf. Das Wasserflugzeug wird schnell vollgetankt. Wenig später betreten zwei unauffällige Männer das Büro der Inland Air in Prince Rupert. Es sind Undercover-Agenten des kanadischen Fischereiministeriums. Beamte in geheimer Mission. Sie machen Jagd auf illegale Fischer an der Nordwestküste Kanadas, auf Wilderer, die geschützte Abalone-Seeschnecken aus dem Pazifik holen und das Pfund auf dem Schwarzmarkt für 80 Dollar verkaufen. Von der Luft aus, sagt einer der Männer, sehen die verdächtigen Boote aus “wie Giraffen in New York”. Aber das Wasserflugzeug darf nicht auffallen, darf kein Misstrauen erregen. Dafür braucht es einen erfahrenen Buschpiloten. Minuten später tuckert Carl Benson mit der DHC-2-Beaver aus der Bucht von Seal Cove hinaus und hebt röhrend ab.
Bruce MacDonald, Eigentümer der Inland Air, braungebrannt und drahtig, prüft die Flugpläne. Alle Piloten, Dave, Garry, Carl, sind jetzt mit Wasserflugzeugen in der Luft. Erfahrene Leute, Bruce kennt sie gut, er kann nur hervorragende Piloten brauchen. Denn da draußen, an der nördlichen Küste British Columbias, ist alles möglich. Da kann das Wetter ändern in drei Wimpernschlägen. Wer nicht blitzschnell das Richtige tut, wenn plötzlich Nebelwände auftauchen, die blind machen, wenn Winde ihre Stärke im Nu verdoppeln und die Maschine tanzen lassen, wer da nicht rechtzeitig einen Fluchtweg findet, der sitzt in der Todesfalle. Das unberechenbare Wetter macht diese Gegend, sagt Bruce, für einen Buschpiloten zu einer der schwierigsten überhaupt.
Aber die Menschen hier können ohne Wasserflugzeug nicht leben, die Bewohner isolierter Dörfer auf Inseln weit draussen im Ozean, die Wasserbiologen, Gesundheitsbeamten, Kraftwerkingenieure, Strassenarbeiter, Holzfäller und Sportfischer, Schüler auf dem Weg in die Stadt, Großmütter mit ihren Enkeln, Patienten auf Arztbesuch. Und so fliegen sie alle im blinden Vertrauen auf das Können der Piloten. “Wir dürfen uns keinen einzigen Unfall leisten”, sagt Bruce.

Er stösst mit dem Finger auf die Landkarte an der Wand, stösst in das Gewirr von Fjorden und Inseln, immer wieder. Da und da und da. An diesen fünf Stellen stürzten Freunde von ihm ab. Alle tot. Auf dem Wasser ertrinken die Opfer meistens im umgekippten Wrack, sagt Bruce. Sind desorientiert vom Aufprall, finden den Ausgang nicht. Inland Air gibt es seit 26 Jahren, und noch nie ist jemand umgekommen.
“Buschpiloten sind Primadonnen. Wir haben grosse Egos. Wir wissen, dass wir gut sind, aber wir prahlen nicht.”
Bruce MacDonald (54), fliegt seit 35 Jahren.
Der Pilot Dave Norman blickt über den Wasserflughafen von Seal Cove. Weisskopfadler kreisen. Daves Blick erstarrt. Er hat etwas auf dem Landesteg erspäht, neben den vertäuten Flugzeugen. Er stürmt ins Gebäude der Inland Air, kehrt mit einem Feldstecher wieder, äugt angestrengt durch die Gläser. Er beobachtet weder gefährliche Wirbel im Wasser. Auch keine aufziehende Wetterfront. Dave mustert einen Piloten der Konkurrenzfirma North Pacific Seaplanes – im offiziellen Fliegeranzug. Inland Air und North Pacific operieren von derselben Bucht aus. Dave lässt den Feldstecher sinken. “Es ist nicht zu fassen”, sagt er. “Dale trägt einen Smoking.”
Was ein echter Buschpilot ist, kostümiert sich nicht. In Blue Jeans, breiten Hosenträgern und gestreiftem T-Shirt stapft Dave zum Wasser hinunter. Manchmal, sagt er, laufen die Passagiere an ihm vorbei, wenn er vor seinem Wasserflugzeug steht, und suchen den Piloten, “sicher einen großen, blonden, schönen Mann in Uniform”. Aber wenn Dave mit der DHC-2-Beaver dröhnend in den Himmel steigt, lässt er alle sehen, wer der König der Lüfte ist. Wie heute, an einem sonnigen, klaren, für Prince Rupert höchst untypischen Flugtag. Dave ist trotzdem auf der Hut. Man kann in Sekunden von der Sonne in den Nebel verschwinden. Das wäre das Ende, denn die Piloten fliegen nach VFR – nach den Sichtflugregeln: Der Pilot hat nur seine Augen und das, was er sieht. Dave zieht Hebel hoch, dreht Knöpfe.

“Hier ist das Fliegen wie eine mathematische Gleichung mit fünfzehn Unbekannten”, sagt er. Alles muss er ständig im Kopf haben, Geschwindigkeit, Wetter, Druckverhältnisse, Treibstoffreserven, Temperaturen, Sicht, andere Flugzeuge, Luftströmungen, die eigene Verfassung, Ebbe und Flut – eine Stimme im Kopfhörer unterbricht ihn. Er grinst. “Die sagen mir, aus welcher Richtung der Wind kommt. Als ob ich das nicht sehen könnte, ich brauche ja nur auf die Wellen zu schauen.”

Von jetzt an ist er allein. Kein Radar, kein Kontrollturm. Nur ein kleiner Bildschirm vor ihm: das GPS, das ihm die Position der Maschine anzeigt. Aber, sagt Dave, nichts ersetzt das Urteilsvermögen des Piloten. Daves Arbeitgeber, die kleine Charter-Fluggesellschaft Inland Air, würde keinen einstellen, der nicht mindestens 2000 Flugstunden mit Wasserflugzeugen auf dem Buckel hat – noch besser, er hätte 6000 Flugstunden. Aber solche Profis gibt es immer weniger. Die Piloten der Inland Air sind alle älter als 50. Junge Leute können nicht genügend Erfahrung vorweisen. Sie schliessen ihre Ausbildung mit rund 200 Flugstunden ab, zu wenig für einen Job an der Westküste. Aber ohne Stelle können sie sich keine Erfahrung zulegen – ein Teufelskreis. Weil sie keine Zukunft in der Branche sehen, weichen junge Leute auf andere Berufe aus. Die Konsequenz, sagt Dave: “Diese Ära der Fliegerei geht dem Ende zu.”
In seiner Beaver sind nur drei der sieben Sitzplätze besetzt, Passagiere, die Grizzlybären im geschützten Khutzeymateen-Tal beobachten wollen. Das kaum belastete Flugzeug segelt wie auf Adlerschwingen durch die Lüfte.
“In zehn Minuten kannst du dich verirren, denn die Berge schauen alle gleich aus, nichts, woran man sich orientieren kann, keine Strassen, keine Häuser, keine Menschen.”
Ken Cote (56) fliegt seit 35 Jahren.
Dave hält auf das schneebedeckte Küstengebirge zu. Gleitet schroff abfallenden Granitwänden entlang. Kleine Bergseen funkeln in der Sonne, die Reste von Gletschern schimmern bläulich. Dave schaut nach hinten: Er sieht es auf den Gesichtern der Passagiere, das Staunen über die gewaltige Schönheit, die Ergriffenheit – und das nervöse Zucken. Eine winzige Flugmaschine in der Unendlichkeit. Nichts als Luft zwischen einem bisschen Aluminium und der Tiefe. Dave lässt die Beaver vom Wind an der Felswand hochtragen. Einen Moment lang sieht es so aus, als würde sie die Bergflanken schrammen. Aber der Aufwind hebt den Flieger elegant über den Grat, dann dreht der Pilot die Metallnase nach unten. Er brüllt “Wir kippen jetzt rüber”, und die Beaver taucht in den Abgrund.
Der hüpfende Magen hat kaum Zeit, sich zu beruhigen, da zeigt Dave auf weisse Bergziegen auf den Felsen. “Hier bin ich früher auf die Jagd gegangen, ich dachte, ich hätte alle ausgerottet.”
Zehn Minuten später setzt er zum Sinkflug auf den Meeresarm im Khutzeymateen-Tal an. Er konzentriert sich. Schwatzt nicht mehr. Die Wasserung ist der heikelste Moment des Fluges. Tödliche Gefahren lauern. Ein unter der Oberfläche schwimmender Baumstamm. Schlimmer noch: ein Wal, der plötzlich in der Landeschneise auftaucht. Ein Adler, der auf die Windschutzscheibe knallt. Eine Untiefe im Wasser. Eine Sandbank darunter, ein unsichtbarer Fels. Die Wellen zu hoch. Oder eine glatte Oberfläche, glasig wie ein schwarzer Spiegel, eine Fata Morgana, auf die man prallt, weil sich die Distanz nicht abschätzen lässt.

Dave zieht eine Erkundungsschlaufe, sucht die Oberfläche genau ab. Dann setzt er die Schwimmer so sachte aufs Wasser wie ein Konditor Schlagrahm auf die Torte. Die Maschine gleitet an eine behelfsmässige Plattform heran, wo bereits Garry MacAuley seine Beaver angebunden hat.
“Buschpiloten sind nicht mehr die Cowboys von einst. Früher ging man grössere Risiken ein. Heute kehren wir öfters um, wenn das Wetter nicht sicher ist.”
Carl Benson (57) fliegt seit 38 Jahren.
Garrys Fluggäste strahlen, sie haben sechs Grizzlys gezählt, auch Garry strahlt, aber er beobachtet unentwegt die Windstärke. 15 Knoten, das ist für den Start im Khutzeymateen immer noch machbar. Bei 25 Knoten müsste er mit der Beaver weiter aus dem Meeresarm hinaustuckern – taxi out nennen es die Piloten -, wo der Wind schwächer ist.
“Es war ein bisschen wirblig”, berichtet er Carl Benson später im Büro der Inland Air. Carl, der an diesem Tag die Flugpläne überwacht, informiert ihn über den nächsten Auftrag: Ein Flug über die für ihre Stürme berüchtigte Hecate-Meeresstrasse nach New Masset auf den Queen-Charlotte-Inseln. Distanz rund 130 Kilometer oder 45 Minuten. Sechs Hobbyfischer warten dort mit vakuumverpackten Lachsen. Die Angler ahnen nicht, dass sie von einem ehemaligen evangelischen Pastor zurückgeflogen werden. Garry liebt die Nähe zum Himmel. Früher flog er auf den Fidji-Inseln Prominente wie den Ex-Beatle Ringo Starr. Er lebte auch in Neuseeland, Japan, Mexiko und Argentinien, aber die Gegend um Prince Rupert, sagt er, übertrifft alles. Winde von 100 Stundenkilometern im Winter. Jähe Wetterumschläge. Peitschender Regen, der auf die Maschine hämmert. Das Husten des gequälten Motors, wenn die Beaver im Sturm auf und ab hüpft. Nebel, wenn das kalte Gletscherwasser aus dem Portland Inlet auf die wärmere Luft vom Pazifik trifft. Nebel, dick wie Isolierwatte. Immer bereit sein für böse Überraschungen. Adrenalin im Blut.
Er läuft zum Landungssteg hinunter, um den Motor der Beaver aufzuwärmen. Ein Leben in Bewegung. “Ein ziemlich einsames Leben ist das”, sagt er. Garry ist Junggeselle, “ein Einzelgänger”.
Vor dem Inland-Air-Gebäude fährt ein schwarzer Wagen vor, eilig entsteigt ein Mann in roter Jacke. Ein Arzt. Auf einem der Kreuzfahrtschiffe, das von Seattle nach Alaska unterwegs ist, gab es einen Notfall. Der Arzt musste den Patienten ins nächste Krankenhaus begleiten, nach Prince Rupert. Jetzt will er den Luxuskreuzer in Ketchikan, Alaska, wieder einholen. Schnell bereiten die Leute von Inland Air die Dokumente für den Flug in die USA vor.
Papierkram. Papierkram. Papierkram.
Bruce MacDonald tigert zwischen Büro und Empfang hin und her. Er sucht Versicherungsdokumente. Seit Bruce im Mai Inland Air als Eigentümer übernommen hat, lastet die Verantwortung auf seinen Schultern. “Ich habe gerade eine Rechnung der Versicherung für drei Monate erhalten”, sagt er: “28000 Dollar.” Dazu 10000 Dollar Steuern für die Firmengebäude. Wie soll da eine kleine Fluggesellschaft überleben”
“In Küstengebieten sind Buschpiloten eine gefährdete Spezies.”
Dale Leekie (58), fliegt seit 38 Jahren.
Bruce tritt ins Freie, zündet eine Zigarette an, stößt den Rauch in die Luft. Reflektiert, wie sich die Branche in den vergangenen Jahren dramatisch verändert hat. Wie die Piloten früher eine Todesspur hinterliessen. Dave sitzt vor dem Eingang und füttert sich und einen Hund mit Krabbenfleisch. “Es ging doch nur darum, es den andern Piloten zu zeigen”, sagt er und knackt den roten Panzer mit blossen Händen. “Man wollte ständig die Konkurrenz übertreffen.”
Als junger Mann flog Bruce in der Arktis, lernte das Handwerk von der alten Garde der Pioniere, die Stiefel, Daunenjacke und ein Messer an der Hüfte trugen. Damals führte er auf seinen Flügen stets einen Schlafsack, eine Flasche Whisky und ein Gewehr mit – für alle Fälle. Einmal zwang ihn ein Motorschaden zur Landung mitten in der arktischen Tundra, den Barren Lands. Vier Tage blieb er da gestrandet, bis ein Air-Canada-Pilot, der über den Nordpol Richtung London flog, sein Notsignal abfing. Viele Piloten kamen nicht so glimpflich davon. Als sich die Abstürze von Buschflugzeugen häuften, griff die kanadische Regierung ein: In den frühen achtziger Jahren traten neue Sicherheitsvorschriften in Kraft. Mit der berauschenden, aber gefährlichen Freiheit der Flugpioniere war es vorbei.
Bruce sucht den Hangar auf, wo der Ingenieur Joe Hidber, dessen Vater aus dem schweizerischen Mels nach Kanada einwanderte, eine Beaver überprüft. Alle hundert Flugstunden werden die Maschinen aus dem Wasser geholt und auf Schäden untersucht. Die Beaver ist ein Mythos in Kanadas Geschichte – und ein Fossil. Sie wird seit 1967 nicht mehr hergestellt. Von 1692 einst produzierten Beaver werden heute aber immer noch an die 1000 Maschinen geflogen. Es gibt keinen Ersatz für sie. Die Piloten lieben die Beaver heiss. Aber die Lebenszeit dieser Maschine neigt sich dem Ende zu. Vielleicht bleiben ihr noch zehn, fünfzehn Jahre. Letzthin, sagt Joe Hidber, reparierte er eine Beaver des Jahrgangs 1948, genau so alt wie er.
“Ein Pilot muss demütig sein. Wenn du denkst, dass du mit allem davonkommst, gehörst du nicht in ein Wasserflugzeug.”
Dave Norman (55), fliegt seit 28 Jahren.
Dale Leekie ist für North Pacific nach Hartley Bay unterwegs. Er will mit seiner Beaver an Höhe gewinnen. “Wir haben eine Inversion”, sagt er. Die felsigen Berge, die er gerade überfliegt, strahlen nach mehreren Sonnentagen Wärme ab. Die warme Luft steigt nach oben, das kann zu Turbulenzen führen. Die Krankenschwester Faith Turner schiebt sich den Kopfhörer übers ergraute Haar. “Wenn ich einen Patienten mit Lungenproblemen hätte, der keinen Druck verträgt”, fragt sie Dale, “könnten Sie dann auch tiefer fliegen?”
Faith hat sich schon oft diesen kleinen Flugzeugen anvertraut, als Kind in der Arktis, wo ihr Vater, ein Engländer, Missionar war, und später als Krankenschwester in den entlegensten Gegenden Kanadas. Wenn sie eine schwangere Frau ins Krankenhaus begleitete, musste sie den Piloten bitten, möglichst immer auf derselben Höhe zu fliegen, denn ein ständiges Auf und Ab beschleunigt die Wehen. Faith arbeitet als Urlaubsvertretung auf der Krankenstation von Hartley Bay: 167 Einwohner, 45 Flugminuten von Prince Rupert entfernt, ein Dorf der Tsimshian-Indianer, die diese Gegend schon seit 5000 Jahren bewohnen. Hier gibt es keine Straße, keinen Arzt, keine Läden. “Und hoffentlich keinen entzündeten Blinddarm”, sagt Faith und schaut auf den glitzernden Ozean unter ihr.

Sie bringt Lebensmittel für zwei Wochen mit. Und die Warnung einer anderen Krankenschwester, die ihr erzählte, der Flug nach Hartley Bay sei ihr schlimmster gewesen: eine aufgewühlte See und fürchterliche Turbulenzen.
Dale nickt. Hohe Wogen rollen oft in die Bucht hinein und machten die Landung schwierig. Vor dem Flug hat er sich am Computer das Wetter in Hartley Bay angeschaut, das ihm eine im Schulhaus installierte Internetkamera übermittelte. Die Sicht war gut.
Dale ist kein Draufgänger. Sein Vater, ein Hobbypilot, war bei einem Absturz umgekommen, als Dale noch ein Teenager war. “Ich mag es, wenn der Flug so ruhig ist, dass sich die Leute nachher nichts zu erzählen haben”, sagt er. Sein Wunsch geht nicht ganz in Erfüllung: Nach einer sanften Landung fällt einer Passagierin beim Aussteigen das Handy ins Wasser.
“Ich habe nur ganz wenige weibliche Buschpiloten getroffen. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass sich Frauen um die Familie kümmern müssen.”
Virginia McRae, arbeitet seit 20 Jahren als Telefonistin im Gebäude der Inland Air
Port Simpson. Es ist die Stille, die sofort auffällt. Eine Stille, die reibt. Kein Kindergeschrei, kein Hämmern aus einem Handwerksbetrieb, nur die spitzen Schreie von Adlern, die sich von den Hausdächern abstoßen und über dem Ozean entschwinden. Schon längst steht das alte Fort der mächtigen Handelsgesellschaft Hudson`s Bay Company nicht mehr in der Bucht, die Überreste brannten 1915 ab. Stillgelegt ist die Fischfabrik am Ufer, menschenleer die staubige Strasse, die nirgendwohin führt. Lax Kw`alaams, “Roseninsel”, nennen die Indianer ihr Dorf.

Draussen auf dem Pazifik erkennt man kleine Punkte – Boote von Fischern, die ihre Netze auswerfen, weil die Regierung die Fischerei gerade für ein paar Stunden freigegeben hat. Zu wenig, um davon zu leben. Plötzlich ein Brummen. North-Pacific-Flug 101. Die Verbindung zur Aussenwelt. Eine 15 Minuten lange Nabelschnur. Dreimal täglich landen Wasserflugzeuge in Port Simpson – für gerade 1000 Einwohner. Manchmal bleiben die Flüge aus, wie die Woche zuvor, als sich der Nebel wie ein Sargdeckel über den Pazifik gelegt hatte. Gillie Sankey klettert vorsichtig aus der DHC-3 Turbo-Otter. Trotz ihres hohen Alters kauft die Indianerin zweimal monatlich in Prince Rupert ein, denn der Laden von Port Simpson ist viel zu klein. “Wir haben Bären im Dorf, deshalb sieht man keine Leute auf der Strasse”, sagt sie, während der Pilot die Fracht auslädt. Bob Bernhardt, ein Fachmann für Ungezieferbekämpfung, lässt sich davon nicht abschrecken, denn er kommt jeden Monat hierher. Heute muss er die Häuser der weissen Lehrer sprayen. Mit zwei eingeflogenen Elektrikern läuft er zum Büro des örtlichen Stammes hoch.
In Seal Cove blickt Gene Story, Besitzer von North Pacific Seaplanes, aus dem Fenster. Er möchte optimistisch sein, aber die Zukunft macht ihm Sorgen. “Die jungen Indianer ziehen in die Städte, Familien bleiben weg. Die Bevölkerung im Norden von British Columbia nimmt immer mehr ab.” Vor zehn Jahren lagen in Seal Cove zwei Dutzend Wasserflugzeuge vertäut, jetzt sind es noch zehn. Damals buchten die Fischerei- und Holzunternehmen ständig Flüge, heute geht es ihnen schlecht. Dazu, sagt Story, werden Strassen zu entlegenen Dörfern gebaut. Und Helikopter nehmen den Wasserflugzeugen immer mehr das Geschäft weg.
Auf der andern Seite der Bucht startet eine Beaver. Bruce MacDonald fliegt zu einem einsamen Bergsee hoch. An solche Orte will er künftig Abenteuer-Touristen hinführen. Man muss sich etwas einfallen lassen, sagt er. Lieber ein paar zufriedene Urlauber hinfliegen als schlechtgelaunte Holzfäller.
Dave Norman sitzt in der Küche der Inland Air vor dem Bildschirm. Er studiert die Wetterkarte. Ein Flug nach New Masset steht an. “Alles zu. Starker Nebel. Ich weiss nicht, ob ich da rausfliegen will”, sagt er. Dann dehnt er seinen breiten Rücken. “Es scheint, dass immer ich gerufen werde, wenn es um einen schwierigen Job geht.” Genugtuung trieft aus seiner Stimme. So etwas kriegt kein grosser schöner Blonder in Uniform hin.