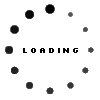Erschienen in der Neuen Zürcher Zeitung am 18. September 2004
Photos: Christopher Grabowski
Nur nicht aufwachen und erkennen, dass der Alptraum wieder beginnt.
Die Hitze. Die Blutsauger. Die entzündeten Gelenke. Schmerzen überall. Zehn Stunden Mühsal, Monotonie, Misere. Zehn Stunden Kampf mit sich selber. Bis zur Erschöpfung.
Nur nicht aufwachen und wissen, dass der Schlaf nicht ausreicht, den gemarterten Körper zu besänftigen.

Halb fünf Uhr morgens im Zeltlager am Archie Creek, einem Flüsschen im Norden der kanadischen Provinz British Columbia. Noch ist alles ruhig. So still, dass man den Specht klopfen hört. Daneben das leise Rauschen des Wassers unter der Brücke. Noch schlafen die jungen Leute, die an diesem drückend heissen Sommertag Zehntausende von Bäumen in Kanadas Wildnis pflanzen werden. Ihre bunten Zelte schimmern wie gigantische Blumen im Gebüsch. Zerbeulte Wohnwagen säumen die stillgelegte Forststrasse. Im Schotterdreck das Strandgut des Vorabends: Gummistiefel, Bierflaschen, ein blauer Pullover.
Plötzlich setzt der Generator ein, dröhnt umbarmherzig. Aus dem Küchenzelt dringt Klappern und Musik. Nun erscheinen von überall her vermummte Gestalten in zerfetzten Gewändern, Rucksack an der Schulter und Wasserkanister in der Hand. Eine junge blonde Frau schleppt sich verschlafen zum Wasserschlauch. “Ich höre auf”, verkündet sie. Niemand hört hin, es ist der meistgehörte Satz am Archie Creek.
“Ich habe genug”, wiederholt Natalie Mathis störrisch. Ihre Schweizer Vorfahren stammen aus Küblis.
Sie hat genug vom Aufstehen um fünf Uhr, vom Baumpflanzen im Akkord. Jeden Tag dieselbe Schinderei. Sie könnte in einer Autostunde in der Holzfällerstadt Prince George sein, dort den Überlandbus nach Hause nehmen, nach Canmore in den Rocky Mountains. 26-jährig ist Natalie, etwas älter als die meisten Pflanzer im Lager. Nur die ganz Jungen halten die Plackerei im Busch durch, und die meisten auch nur drei, vier Monate im Jahr. Im Winter arbeitet sie als Kellnerin in einem Skiort. Aber als Baumpflanzerin verdient sie mehr. Viel mehr.
Natalie geht ins Küchenzelt, wo sich siebzig Leute Tonnen von Kalorien zuführen: Schinken, Eier, Käse, Pfannkuchen, geschmortes Gemüse, Früchte, Müesli. Die Zeit eilt. Den Tages-Proviant einpacken, noch eine Zigarette rauchen, seinen Hund suchen, sich im Laufen die Zähne putzen, ins Gebüsch pinkeln, herausfinden, in welchem Geländefahrzeug man Platz hat. Spaten werden auf den Truck geworfen, dann die Säcke für die Setzlinge, die Gummistiefel mit den Spikes.

Andy MacArthur treibt die Ewigspäten an. Er ist der Verantwortliche für die Pflanzer am Archie Creek. Früher war er auch einer von ihnen, jetzt hebt er sich ab: Er hat geduscht und trägt Kleider ohne Löcher. MacArthur ist Manager bei Celtic Reforestation in Prince George, einer der über 200 Firmen in Kanada, die abgeholzte Wälder wieder aufforsten. Sie stehen im Dienste der großen Holzkonzerne, die ihnen die Aufträge geben.
Früher haben die Unternehmen kolossale Flächen wegrasiert, ohne für den Nach-Wuchs zu sorgen. Aber seit 1987 müssen die Holzkonzerne in British Columbia auf eigene Rechnung wieder aufforsten. Forstexperten der Provinzregierung bestimmen, welche Arten von Nadelbäumen in welchen Gebieten angepflanzt werden, damit es ökologisch sinnvoll ist. Die Arbeit machen die Baumpflanzer, ein Heer von jungen Leuten, die Jahr für Jahr unter brutalen Bedingungen die Setzlinge in den Boden stampfen. Im Sommer schuften Hunderte von ihnen in der Wildnis um Prince George. In dieser Region ist der Wald der wichtigste Rohstoff: In einem Umkreis von 300 Kilometern um die Stadt wird mehr als ein Fünftel von Kanadas Bauholz-Produktion erzielt.
6 Uhr 15. Die Motoren der Gelände-wagen fauchen. Die dreckverspritzten Vehikel hasten ruckend über Waldstrassen aus steiniger Erde. Jedesmal, wenn die Reifen auf ein Schlagloch treffen, hüpft die CD von Pink Floyd aus dem Takt. Natalies Gesicht hellt sich auf. Im Wageninnern legt sich ein Gruppengefühl wie weiche Daunen über die rebellierenden Seelen. Jessica Fox sitzt neben ihr, im meergrünen ärmellosen T-Shirt, hauteng und kurz, ein meergrüner Schal im blonden Haar, ein Lachen wie ein Wasserfall, braune starke Arme. Jessica lässt sich auf Vancouver Island zur Krankenschwester ausbilden. Die beiden sind zwei Tage zuvor im Zeltlager angekommen. Das Camp ist ein Reservoir an gutaussehenden athletischen jungen Männern. Zwei Drittel der Baumpflanzer sind Studenten, der Rest vor allem Extremsportler, Künstler, Freiheitsliebende, Musiker, Abenteurer. “Ein Haufen Unangepasste”, sagt Natalie. Das gefällt ihr.

Die Baumpflanzer vom Archie Creek sind für den kanadischen Canfor-Konzern aus Vancouver unterwegs. Canfor Corp. dominiert die Wälder um Prince George: Der Konzern beutet dort ein Forstgebiet von der Grösse der Schweiz aus, das ihm aber nicht gehört. In British Columbia sind rund 95 Prozent der Wälder in Staatsbesitz. Die Holzproduzenten erhalten von der Regierung gegen Gebühren die Lizenz zum Abholzen. Das missfällt den Amerikanern, deren Wälder mehrheitlich Privateigentum sind. Die US-Regierung behauptet, die Forstwirtschaft Kanadas sei subventioniert, was sie bislang aber nicht hat beweisen können. Sie bestraft die Kanadier trotzdem mit massiven Schutzzöllen auf kanadischen Holzexporten in die USA.
Die Wagenkolonne kommt nach einer Stunde zum Stehen. Einige Pflanzer sind wieder im Schlummer versunken – trotz Pink Floyd in Konzertlautstärke. Ein Helikopter landet mitten auf der Schotterstrasse. Andy MacArthur gibt die Sicherheitsbestimmungen für den Flug durch. Die Pflanzer ducken sich unter den Rotoren.
Oben am Berg werden sie auf dem kahlgeschlagenen Gelände ausgesetzt, springen von einer behelfsmässigen Plattform aus Baumstämmen herunter, den Rotorenflügeln ausweichend. Die Rucksäcke werden ihnen nachgeworfen. Vier Frauen und drei Männer sind in der Gruppe des Aufsehers Dan Ouellette. Sie schauen sich das Terrain an und ahnen schon Schlimmes. “Ignoriert die Hemlock-Tannen”, erklärt Dan im Pflanzerjargon, “messt aber Balsam ein, wenn er schön ist wie ein Christbaum. Taucht ein Bär auf, lasst es die anderen wissen.”

Die Aussicht von hier oben ist eine Million Dollar wert: mächtige Schneeberge am Horizont, unten windet sich der Strom Fraser durch eine endlose bewaldete Ebene. Weite, Freiheit, Entrücktheit. Aber die Pflanzer brauchen nur den steilen Hang hoch zu kriechen, um zu verstehen: Dieser Grund ist wie ein Boden mit tausend Falltüren. Vor rund zehn Jahren wurde das Gebiet kahlgeschlagen. Die Trümmer, gigantische Wurzelstöcke, unbrauchbare Holzstämme, ausgehobene Sträucher und abgebrochene Äste, hat man einfach zurückgelassen. Jetzt ist alles überwachsen, mit Blumen, Büschen, wuchernden Pflanzen, bösartigen Gewächsen. Devil`s Club zum Beispiel, der Teufelsknüppel, dessen Stacheln sich durch die Kleider tief ins Fleisch eingraben und Qualen bereiten.
Brian St.Germain schaut um sich. Entsetzen steht in seinem Kindergesicht. Glitschige Baumstämme am Boden. Geröll und Dornen, Fangschlingen, verräterische Untiefen. Der 20-jährige Kanadier ist einer der “Rookies”, ein Anfänger. Die häufigen Besuche im Fitness-Club in Prince George haben ihn nicht auf diese Tortur vorbereitet.
Brian hat zwar gelernt zu “spacen”, die Setzlinge im richtigen Abstand im Erdboden zu versenken. Er kann in einem Kreis mit einem vorgegebenen Radius von vier Metern acht Bäume pflanzen, sodass alle gleich weit voneinander entfernt sind. Zwar nicht so schnell wie die anderen in der Gruppe, wie Jessica zum Beispiel, die in der Minute mehrere Bäume pflanzt. Sie rammt den Spaten in die Erde, weitet mit einer schnellen Bewegung das Loch, während sie bereits mit der andern Hand einen Setzling aus dem Sack hinten an ihrer Hüfte holt. Bücken, Wurzel sachte hineinhängen, Erde festklopfen. Und beim Aufrichten des Körpers schon die nächsten zwei, drei Standorte für die Tännchen ausmachen. So verliert man keine kostbare Zeit.
“30 Cents”, sagt Dan Ouellette mit seinem französischen Akzent aus Montreal. Dreissig Cents erhalten die Arbeiter für jeden gepflanzten Baum. Das ist ein Zuschlag für das mörderische Terrain. Am Vortag haben die Pflanzer in einem anderen Gelände 21 Cents verdient. Heute ist alles schwieriger: Das Gebiet, 1,5 Kilometer lang mit einem Höhenunterschied von 250 Metern, ist vor sieben Jahren schon einmal aufgeforstet worden. Aber viele Jungtannen haben die langen Winter nicht überlebt. Jetzt muss nachgeforstet werden. Erst wenn die Nadelbäume unabhängig gedeihen können, geht das Gebiet von der Verantwortung des Holzkonzerns wieder in die Obhut der Provinzregierung über.

Brian St.Germain schüttelt den Kopf. Er muss jetzt nicht nur pflanzen, sondern auch noch die vor sieben Jahren platzierten Setzlinge unter all dem Gestrüpp finden, um zu wissen, wo er seine Bäume anbringen kann. “Es ist verrückt”, klagt er. Heute wird er nicht viel Geld machen. Brillieren würden hier aber nicht einmal die “Highballers”, die Stars unter den Pflanzern, die an manchen Tagen bis zu 2800 Bäume in den Boden ballern.
Die Säcke, gefüllt mit fussgrossen Fichten, hängen um Brians Hüfte. Schulterriemen halten das Gewicht. Etwa 25 Kilogramm schleppt er nun den Hang hoch. Macht ein paar Schritte und fällt schon ins Bodenlose.
Dan Ouellette, klein und drahtig, mit schwarzem Lockenkopf und Stirnband, steigt unermüdlich durchs Gelände. Ein Pflanzer soll, so heisst es, im Schnitt 16 Kilometer pro Tag zurücklegen. Ein Aufseher macht wahrscheinlich 24. Dan ist unzufrieden, weil seine Leute die Fläche zu dicht bepflanzen. Sie übersehen manche der früheren Setzlinge. Mit geübtem Auge entdeckt Dan falsche Abstände zwischen Jungtannen, Setzlinge, deren Wurzeln gebogen statt gerade im Erdloch stecken, ideale Standorte, die von den Pflanzern ignoriert wurden.
Jetzt zeigt er auf einen Baumstrunk. Der speichert Wärme, eine Heizung für zarte Pflänzchen. “Vergesst nicht, Leute, das wäre eine gute Stelle gewesen”, brüllt er. “Amen, Bruder”, ruft Natalie zurück. Wer pfuscht, bereut es schnell. Dann muss man alles herausrupfen, alles neu pflanzen. Verlorene Zeit, verlorenes Geld. Das trifft auch Dan, denn er verdient 15 Prozent dessen, was seine Gruppe erarbeitet.

Alle sind hier der Geldes wegen. Niemand verhehlt das. Geld, um reisen zu können. Fürs Studium. Um Musik, Kunst zu machen. Um im Rest des Jahres Arbeitslosenunterstützung zu beziehen. Dafür schuften sie jetzt wie Pferde: Vier Tage Akkord, ein Tag frei, vier Tage Akkord, ein Tag frei.
Die Sonne glüht. Dabei hatten die Pflanzer geglaubt, nach dem sintflutartigen Regen in der Woche zuvor das Schlimmste hinter sich zu haben. Schlottern. Klamme Finger. Durchdringende Nässe. Waten im Morast.
Und jetzt diese unerträgliche Hitze.
Jessica Fox torkelt den Berg herunter. Schweiss läuft ihr in die Augen, mit ihm der giftige Mückenspray. Jessica setzt den Wasserkanister an die Lippen, lässt sich vollaufen. Die Wasserflasche wartet immer unten, dort, wo die Setzlinge aus Kartonbehältern in die Säcke eingefüllt werden. Noch mehr Gewicht will niemand buckeln. Sobald Jessica stillsteht, wird sie von Mückenschwärmen attackiert. Bremsen, Mosquitos – und die schlimmsten: “No-see-ums”, so winzig, dass man sie nicht sieht, aber sie reissen die Haut auf und das Blut rinnt herunter.
Die Körper der Pflanzer sind voller entzündeter Schwären, schwarzer Flecken, roter Wunden, Ausschläge und Blasen. “Ich zeige mich im Badeanzug nur andern Pflanzern”, gesteht Natalie, die sich zu ihrer Freundin gesellt. Jessica streckt ihren Rücken durch. “Nach meinem ersten Jahr dachte ich, vergiss es.” Aber nun ist sie schon fünf Jahre dabei, wird immer besser. In einem Kraftakt sattelt sie ihre vollbepackten Säcke, ein menschliches Maultier, das sich selber antreibt. Beginnt den beschwerlichen Tanz durchs Dickicht. Beim Pflanzen taucht ihr Rücken auf und ab wie eine Walflosse aus dem Ozean.
Michael Ross, ein 25-jähriger Student aus der Provinz Quebec, hat nur eine Hand. Ein Geburtsfehler. Er ist trotzdem schneller als viele andere, nach vier Pflanzjahren. “Das Härteste ist, nicht innezuhalten, immer weiterzumachen”, sagt er.
Nicht aufgeben. Stoßen, Loch öffnen, Setzling greifen, bücken, festklopfen.
Schritt-Schritt. Stossen. Greifen. Bücken. Klopfen. Schritt-Schritt.
Tausend mal am Tag. Nervtötend. Geisttötend. Das Handgelenk schmerzt. Der Arm. Die Füße. Das Kreuz. Hitze. Mücken im Ohr, im Mund, in den Augen. 30 Cents. Wie viele Bäume noch? Dreihundert? Vierhundert? Den Grund lesen. Die Geographie des Bodens. Der nächste, bücken, Schritt-Schritt. Nicht aufgeben.

Zwei Pflanzerinnen zünden sich während einer kurzen Rast ein Haschischpfeifchen an. Die Firma Celtic verbietet es. Aber viele Pflanzer rauchen heimlich “Pot”, zwischen den Aufstiegen, am Abend im Lager. Die Pfeifchen verschwinden, als der Aufseher erscheint. Dan Ouellette sieht sich die Umgebung an. “Das gerodete Waldstück hier ist riesig”, sagt er. “196 Hektaren. Das ist noch die alte Schule.” Heute müssen die Holzkonzerne dazwischen große Gebiete für die wilden Tiere unberührt lassen. In Kanada wird jedes Jahr rund eine Million Hektar Wald kahlgeschlagen. Hier im Norden, wo der Winter sieben Monate dauert, brauchen die Nadelbäume zum Nachwachsen rund 150 Jahre. Im milderen Klima an der Südwestküste 60 Jahre.
Die Holzindustrie ist ungeduldig. Im Forstlabor der Universität von Prince George wird danach geforscht, was Tannen schneller wachsen lässt. Gegründet und finanziert hat das Labor der ehemalige Konzernleiter des Holzproduzenten Slocan. Die Baumpflanzer tragen dazu bei, dass die Industrie eines Tages wieder ernten kann. Mit den Tännchen lassen sie einen Teil von sich selber in der Natur zurück.
Dan Ouellette erhält einen Ruf über Funk: ein Unfall in der anderen Gruppe, die weiter vorne arbeitet. Ein Pflanzer ist auf einem liegenden Baumstamm ausgerutscht, ein abgebrochener Ast hat sich in seine Seite gebohrt.
17 Uhr. Endlich. “Lasst eure Säcke und Spaten hier oben” , ordnet Dan vor dem Rückflug an. Natalie Mathis will ihre Werkzeuge mitnehmen. Dan wird misstrauisch. “Gibst du auf?” Natalie verneint. Ein scharfer Wortwechsel folgt. “Wenn du aufhören willst, dann sag es gleich”, fordert der Aufseher. Natalie streitet sich mit ihm, dann gibt sie nach, unwillig.

Der Helikopter bringt die erschöpften Pflanzer ins Tal. Vor der Abfahrt trägt Andy MacArthur die Tagesergebnisse in eine Liste ein. Jessica hat 700 Bäume gepflanzt. Das sind rund 200 Franken. Natalie kommt auf 530 Stück.
Die Frauen seien oft besser als die Männer, sagt Andy MacArthur. Manchmal kommen Machos an, deren Maul noch größer ist als die Muskeln, und nach einer Woche machen sie schlapp. Für das Pflanzen braucht es auch Geschmeidigkeit. Und vor allem mentale Stärke.
“Du kannst ruhig deinen Kopf auf meine Schulter legen”, sagt Michael Ross im Geländewagen zur müden Frau neben ihm. Minuten später schläft er tief.
18.30 Uhr. Zurück im Zeltlager gibt es nur einen rohen Trieb: Essen. Kara Ferguson, die seit neun Jahren für Celtic kocht, bemisst dreifache Portionen für alle: Suppe, Braten, Peperoni, Rosenkohl, Randen, Kartoffelpüree, Salate, Erdbeertorte. Mit tätowierten Armen schwingt sie schwere Pfannen und Platten vom Herd zur Anrichte. Der Ring in ihrem Bauchnabel zittert.
Kara ist nichts fremd. Sie rät Neuankömmlingen, im Gebüsch zu scheissen, die Freiluftklos seien zu garstig. Und warnt: “Passt auf Bären auf, einer war gestern in der Nähe.” Zu Kara gehen die jungen Männer, wenn sie sich die Geschlechtsteile an den um die Hüfte gebundenen Pflanzensäcken wundgescheuert haben. Sie gibt ihnen feines Maismehl – zum Kühlen.
Akkord-Pflanzen sei eine sehr emotionale Sache, sagt Kara: “Es intensiviert alles.” Das Schwere und das Gute. Romantische Beziehungen entstehen schnell, Sex ist Trost. “Sie sind wie Karnickel, Mann”, gluckst Kara. Sie lacht auch, wenn sie nervös ist. Zum Überspielen. Wie damals, vor zwei Jahren, als Nicole Hoar beim Autostoppen westlich von Prince George spurlos verschwand. Die 25-jährige Studentin hatte bei Celtic als Pflanzerin gearbeitet. Ihre Kameraden waren fassungslos. Kara gestikuliert. “Ich musste eine Mutter für alle sein.”
Ein Bild der Vermissten hängt in den Räumen des Hauptsitzes von Celtic Reforestation in Prince George. Der Inhaber Dave Wilson war früher selber Baumpflanzer, seine Frau ebenso. Es sei ein freies Leben ausserhalb der Institutionen, sagt Dave, 48jährig, ein Bär von einem Mann. Die Freiheit hat ihren Preis: “Man kann dieses Arbeitsumfeld nur schwer kontrollieren. Deshalb können Ausbeutung und Missbrauch der Pflanzer vorkommen.” Seine Firma genießt einen guten Ruf, hat 21 Jahre in einer Branche überlebt, in der immer härter um die Aufträge der Holzkonzerne gekämpft wird. Manche Konkurrenten erledigen die Arbeit zu Dumpingpreisen – zulasten der Löhne der Pflanzer. Firmen wie Celtic und ihre 400 Mitarbeiter hängen von den Forstgiganten ab. “Wir sind ganz unten am Totempfahl”, erklärt Dave Wilson.
Aber selbst dort unten ist das Leben manchmal gut. Am Archie Creek stürmen die Pflanzer ein paar Autos für eine Spritzfahrt zum nahen See. Die Hitze ertrinkt im kalten Wasser. Das Schöne ist besser als je zuvor. Dieses unbeschreibliche Gefühl von Sauberkeit nach der Haarwäsche. Mit andern Pflanzern vor dem Küchenzelt sitzen, Tequila trinken, Musik hören. Eine Verbundenheit spüren, wie es sie nur unter extremen Bedingungen gibt. Stolz sein auf das Geleistete, auf die eigene Stärke. Vor Müdigkeit lachen, lachen, lachen.
Am nächsten Morgen sitzen die Pflanzer niedergeschlagen auf dem Brückengeländer. Sie können nicht losfahren. Der Lastwagen mit den gekühlten Setzlingen, die von einer Baumschule in Vancouver stammen, ist noch nicht eingetroffen. Über 200000 Tännchen, drei Tage Arbeit. “Wie kann man uns das nur antun?” stöhnt einer.
Stundenlanges Warten. Verlorenes Geld.
Natalie füllt ihren Kaffeebecher im Küchenzelt. “Natürlich bin ich wieder dabei”, sagt sie. “Die brauchen sich keine Gedanken zu machen. Ich bringe den Mist zu Ende”